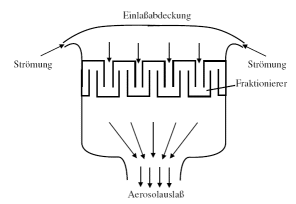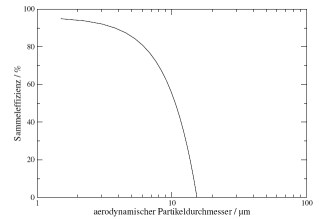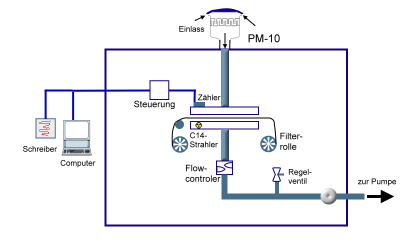> ACCENT de > UQ 1 Nov Dez 06 Partikel in der Luft > F: Partikel-Messung
> ACCENT de > UQ 1 Nov Dez 06 Partikel in der Luft > F: Partikel-Messung
|
Forschung A: Messung von Partikeln in der Luft
Die Luft wissenschaftlich zu untersuchen bedeutet, verschiedenste Verbindungen zu beobachten und zu messen. Einige von ihnen verteilen sich weltweit und treten in relativ stabilen Konzentrationen auf. |
Zu ihnen gehört das Kohlendioxid. Es kann in sogenannten „Kanistern“ für Luftproben gesammelt werden. Dabei handelt sich um Stahlgefäße mit einem Ventil, die mit einer Vakuumpumpe leer gepumpt werden. Im Anschluss wird die Außenluft hineingesaugt und die Menge an verschiedenen Gasen z.B. mittels eines Massenspektrometers bestimmt. Siehe auch: ACCENT Magazin Nr.1 zu CO2 Messungen. |
|
|
Was für das stabile Kohlendioxid recht einfach möglich ist, ist für andere Gase komplizierter. Ein reaktives Gas, wie Ozon zum Beispiel, würde im Kanister weiter reagieren oder an der Wand zerstört werden und bei der Analyse in weit geringeren Konzentrationen vorhanden sein, als es ursprünglich in der Luft war. |
|
Auch Partikel in der Luft müssen auf andere Weise bestimmt werden. Partikel müssen zum einen nach der Größe unterschieden werden. Es ist auch sehr wichtig, wo sie gemessen wurden. Unmittelbar neben einer viel befahrenen Autobahn wird man mehr Partikel finden, als über einem verschneiten Feld. |
|
In der Regel werden Partikel mit Hilfe von Filtern gemessen. Für den Feinstaub mit einer Partikelgröße von kleiner als 10 µm ist die Beta-Absorption mit vorgeschaltetem PM-10 Kopf ein gängiges Verfahren. Was bedeutet das? |
Beim Sammeln der Partikel soll zunächst vermieden werden, dass die großen Partikel mitgemessen werden. Der sogenannte PM-10 Kopf ist nichts anderes als ein kleiner Irrgarten, in dem größere Partikel beim Hineinsaugen gegen die Wände fliegen und dort haften bleiben. Partikel kleiner 10 µm hingegen passieren. |
|
|
Natürlich kann man dabei nicht garantieren, dass ein Partikel mit 9 µm Durchmesser hindurchkommt, während einer von 11 µm hängen bleibt. Um dennoch die Werte vergleichen zu können, werden solche Geräte standardisiert und zeigen die in der Abbildung dargestellte typische Kurve mit zunehmender Sammeleffizienz bei Partikeldurchmessern d < 10 µm.
|
|
Das Messprinzip typischer Staub-Messgeräte basiert auf der Absorption der von einer radioaktiven Quelle emittierten Betastrahlen durch Partikel, die aus einem Umgebungsluftstrom gesammelt wurden. |
Vor jedem Sammelzyklus wird die Impulsrate des unbeladenen Filterbandes gemessen, dann wird exakt auf diesem Filterflecken während einer vorher festgelegten Zeit Staub gesammelt und schließlich die Impulsrate des beladenen Filterbandes gemessen. Die Differenz der beiden Impulsraten wird im Gerät ausgewertet und als Staubkonzentration in μg/m3 angezeigt. |
|